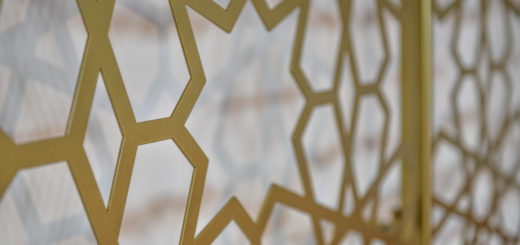Die Frage des doppelten Anteils. Eine Erbschaftspraxis im Spiegel des schweizerischen Rechtsrahmens und der Reformdynamik im Islam

Erbschaftspraktiken stellen ein Gebiet dar, auf dem sich die juristischen Bedingungen eines Territoriums, religiöse und/oder kulturelle Prinzipien sowie persönliche und gar emotionale Erwägungen kreuzen.
Das islamische Erbrecht ist eines der komplexesten Rechtsgebiete des Islam, auf dem vielschichtige juristische Positionen die Anteile der Erben und Erbinnen in Abhängigkeit der Familienstruktur sowie des Ranges einer Person in der Erbfolge genau bestimmen.
Die erbrechtliche Praxis, nach der die Söhne eines/rVerstorbenen vor den Töchtern bevorzugt werden, ist sicherlich sowohl die bekannteste als auch die am meisten umstrittene Regeln in diesem vielschichtigen Feld. Dass ein Bruder einen doppelt so hohen Erbanteil erhält wie seine Schwestern, wird durch die koranische Sure 4 «Die Frauen» begründet. In Vers 11 dieser Sure heißt es: «Allah schreibt euch hinsichtlich euerer Kinder vor, dem Knaben zweier Mädchen Anteil zu geben.»[1] Diese sogenannte Regel des doppelten Anteils findet in vielen Ländern Anwendung, in denen der (sunnitisch oder schiitisch ausgeprägte) Islam die Religion der Mehrheitsbevölkerung darstellt. Aber nicht nur dort: Auch in Einwanderungsländern wie der Schweiz kommt es vor, dass muslimische Familien dieser islamisch-juristischen Position folgen möchten und sich die Frage stellen, wie sie das staatliche Zivilrecht mit der islamischen Erbrechtspraxis in Einklang bringen können.
Basierend auf einer explorativen Studie aus dem Jahr 2018, im Rahmen derer 11 muslimische Autoritätspersonen (Imame, Prediger oder Lehrperson) interviewt wurden, hebt dieser Beitrag drei Zugänge zum Umgang mit erbrechtlichen Fragen in der Schweiz hervor (Schneuwly Purdie & Stegmann, 2019). Die Antworten zeigen, dass die Befragten teils eine Präferenz für den ‘doppelten Anteil’ zugunsten der Söhne haben; teils eine automatische Übernahme des helvetischen Zivilrechts fordern und teils für eine neue Interpretation der religiösen Normen plädieren, die die lokalen Realitäten berücksichtigt und mit dem Schweizer Zivilrecht letztlich nicht mehr in Konflikt steht.[2] Schliesslich erläutern wir, wie sich die in diesen Positionen wider spiegelnden Überlegungen zur Erbschaftspraxis von Musliminnen und Muslimen in der Schweiz zu den lebhaften Debatten verhalten, die aktuell in mehreren mehrheitlich muslimischen Ländern über die Reformen des Erbrechts geführt und insbesondere an grundlegende Fragen der Gerechtigkeit[3] sowie auch eine weibliche Koranexegese geknüpft werden. Letztere Form der Exegese plädiert für eine Neuinterpretation des Koran und der Prophetenaussagen unter dem Blickwinkel sozialer Gerechtigkeit und Gleichstellung.
Unterschiedliche Zugänge zur islamischen Erbschaftspraxis in der Schweiz
Zunächst muss betont werden, dass alle befragten Imame, religiöse Lehrpersonen und Verantwortliche sich zum Vorrang des Schweizer Rechts vor religiösen Vorschriften bekennen. Sollte also zwischen den Erben und Erbinnen in Bezug auf einen Grundsatz des islamischen Erbrechts oder die Schweizer Gesetzgebung ein Konflikt entstehen, so sind die Autoritätspersonen der Auffassung, dass der Muslim oder die Muslimin verpflichtet ist, sich an das Schweizer Recht zu halten und zu akzeptieren, dass die islamischen Bestimmungen keine Anwendung finden. Mehrere unserer Gesprächspersonen betonen jedoch auch, dass die Erblasser und Erblasserinnen sich bemühen sollten, die religiösen Prinzipien im Rahmen des in der Schweiz gesetzlich Erlaubten umzusetzen, auch wenn, wie im Folgenden gezeigt wird, ihre Meinungen darüber auseinander gehen, ob die Vorschriften wörtlich angewendet oder der «Geist» der Quellen respektiert werden sollte.
Im Rahmen dieser Überzeugungen lassen sich drei Ansätze unterscheiden. Der erste ist der klassische Ansatz, demzufolge die in den schriftlichen Quellen (Koran und Sunna) ausgedrückten Prinzipien Anwendung finden sollten. Für die Interviewten mit dieser Haltung ist der Koran das vollkommene Wort Allahs, dessen Regeln als ewig gültig angesehen werden und von den Menschen nicht ignoriert werden sollten. Die Befürworter dieses Ansatzes fordern also die Einhaltung der islamischen Erbanteile, wie sie in den Texten festgelegt sind, auch wenn dies eine unterschiedliche Behandlung von Söhnen und Töchtern bedeutet. Sie empfehlen, die in der Schweiz übliche Praxis in Richtung der islamischen Pflichtanteilslehre zu korrigieren, indem die Erbquoten durch ein Testament oder den freiwilligen Verzicht auf Pflichtteilsansprüche angepasst werden. Der zweite ist der sogenannte pragmatische Ansatz, der dem Schweizer Recht stets Vorrang einräumt. Vertreter dieses Ansatzes sehen es als absolut legitim an, dass ein/e in der Schweiz lebende/r Muslim/in in Bereichen, die de facto das Zivilrecht betreffen, den Schweizer Gesetzen folgt und nicht versucht, islamische Rechtsnormen anzuwenden. In diesem Fall erhalten Söhne und Töchter den gleichen Anteil am Erbe. Der dritte Ansatz verfolgt eine kontextbezogene Interpretation des Koran. Die diesem Ansatz folgenden Befragten sind der Ansicht, dass die islamischen Erbrechtspositionen auch aus religiöser Sicht heute in der Schweiz keine Anwendung mehr finden sollten. Sie betrachten den Koran als einen zwar heiligen, aber für die Zeit der Offenbarung charakteristischen Text und sind der Ansicht, dass der Koran im Kontext seiner Entstehung auf der arabischen Halbinsel im 7..Jahrhundert verstanden werden muss. Hier lag die ökonomische Verantwortung für die Familie allein bei den Männern – das heisst, dass ein Mann für den Unterhalt seiner Familienmitglieder zuständig ist, einschliesslich von Schwestern in finanzieller Not (Lamrabet 2017, S. 150). Nach Ansicht einiger Befragter müssen vor allem die Werte der Gleichstellung und sozialen Gerechtigkeit, die der Koran vermitteln wolle, respektiert werden. Die konkreten koranischen Angaben zum Erben hingegen können heute nicht mehr angewendet werden, weil sie für eine Familien- und Gesellschaftslogik definiert wurden, die in der Schweiz heute (nahezu) nicht existiert.[4] Diese Befragten plädieren für eine neue Textlektüre unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen und betonen, dass die Mehrheit der muslimischen Frauen in der Schweiz berufstätig ist und zum Familienunterhalt beiträgt, während manche gar alleinerziehend seien und für den gesamten Finanzhaushalt aufkommen. Das islamische Prinzip der sozialen Gerechtigkeit müsse folglich heute einer Realität Rechnung tragen, in der Brüder nicht für die finanziellen Bedürfnisse ihrer Schwestern aufkommen müssen. Einige der befragten Personen vertreten zudem die Ansicht, dass der Islam jurisdiktionelle und exegetische Instrumente zur Kontextualisierung der Erbschaftsregeln bereitstellt, so dass die islamischen Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit und Gleichstellung, die im Einklang mit der Schweizer Erbschaftspraxis stehen, Anwendung finden.
Erbschaftsdebatten in muslimischen Ländern
Im Gegensatz zum Schweizer Kontext, wo eine Auseinandersetzung um das islamische Erbrecht ein nur marginales Randthema darstellt, sind in verschiedenen Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit, wie z.B. die Maghreb-Staaten, Ägypten, Malaysia oder Indonesien, immer wieder intensive Debatten um Status und Inhalte des islamischen Erbrechts zu beobachten. Die dabei vorgebrachten Forderungen weisen Überschneidungen zu den Positionen der von uns interviewten religiösen Autoritätspersonen in der Schweiz auf. In Marokko beispielsweise war die Reform des Mudawwana (Familiengesetzbuch) im Jahre 2004 ein wichtiger Schritt in Bezug auf die Stärkung der Frauenrechte, auch wenn die Erbschaftsgesetze letztlich von den Neuregelungen noch nicht betroffen waren.[5] Stimmen wie die marokkanisch-feministische Autorin Asma Lamrabet fordern eine kritische Neuinterpretation der Koranverse zum Erben, und verweisen auf die Diskrepanz zwischen ihren historischen Entstehungskontexten und den heutigen Realitäten. Lamrabet plädiert für eine Kontextualisierung der Verse und dafür, dass Frauen in Berufung auf die koranische Ethik der Gleichheit und Gerechtigkeit die gleichen Rechte zugesprochen werden wie den Männern (Lamrabet, 2017). In Tunesien wurde 2018 ein Gesetzesvorschlag zur Einführung gleicher Erbanteile für Söhne und Töchter vorgelegt, was einen grossen Fortschritt in der Debatte um mehr Gleichberechtigung für Frauen darstellte. Auch wenn die vorgeschlagenen Reformen auf starken Widerstand stießen und bis heute nicht umgesetzt wurden zeigen sie, dass das Erbrecht zu einem zentralen Thema im Kampf für die Rechte der Frauen geworden ist. In Algerien sind ähnliche Diskussionen zu beobachten, hier stellen feministische Bewegungen und Wissenschaftler/innen häufig die Grundlagen der ungleichen Erbanteile in Frage.
Die andauernden Reformprozesse signalisieren eine zunehmende Infragestellung der traditionellen patriarchalischen Auslegungen des islamischen Erbrechts. Sie spiegeln auch den wachsenden Druck wider, die nationalen Gesetze an die Grundsätze der Gleichberechtigung anzupassen.
Die Rolle der femininen Exegese für die Neudefinition von Normen
Die Reformen des Erbrechts in den oben genannten Ländern entspringen vielfältigen Forderungen, die sich wiederum aus verschiedenen politischen, sozialen oder auch theologischen Argumenten speisen. Hierzu gehört auch die feminine Koranexegese. Dieser Zugang gewinnt seit den 1990er Jahren zunehmend an Bedeutung und hat in der Erbschaftsdebatte neue Perspektiven eröffnet. In den religiösen Schriften selbst wird dabei nach Möglichkeiten gesucht, die patriarchalische Interpretation von Ungleichbehandlung der Frauen in Erbangelegenheiten in Frage zu stellen. Gelehrte wie Amina Wadud, Asma Barlas und Fatima Mernissi haben in ihren Analysen von Korantexten dargelegt, dass erbrechtliche Ungleichheiten nicht als unveränderliche Vorschriften, sondern als Reaktionen auf spezifische historische Kontexte zu verstehen sind (Barlas, 2002, S.177-178; Mernissi, 1989, S.115-140; Wadud, 1999, S. 87-88. Sie heben Gerechtigkeit und Gleichbehandlung als zentrale Werte des Korans hervor und plädieren für eine fortschreitende Neuinterpretation der Rolle der Frau in der Gesellschaft.
Schlussfolgerung
In der Schweiz könnten Reformbestrebungen wie zum Beispiel die feminine Koranexegese, die für soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung einsteht, ein wertvolles Instrument für Muslime und Musliminnen darstellen, die ihre religiösen Praktiken mit den rechtlichen und sozialen Rahmenbedingungen der Schweiz in Einklang bringen wollen. Diese Bestrebungen nämlich verweisen auf Möglichkeiten, wie religiöse Normen, kulturelle Praktiken und rechtliche Anforderungen neu verkoppelt werden können, so dass sie den Bedürfnissen von Muslimen und Musliminnen in ihren spezifischen Lebenskontexten gerecht werden. Die Reformdebatten zum islamischen Erbrecht in mehrheitlich muslimischen Ländern entwickeln sich in Richtung des Schweizer Erbrechts: Das Ausmass der gesellschaftlichen Debatten, die Forderungen nach gesetzlichen Reformen und die an erbrechtliche Traditionen geknüpften Identitätsfragen belegen, dass eine Praxis an der Schnittstelle zwischen dem Zivilen und dem Religiösen zu einem Raum mit neuen Modalitäten der Bezeugung religiöser Zugehörigkeit werden kann.
[1] Nach der 1989 bei Reclam erschienenen Übersetzung von Max Henning.
[2] Es muss betont werden, dass der gegenwärtige Stand der Forschung es nicht erlaubt zu sagen, ob muslimische Laienperspektiven sich jeweils einer der drei Positionen zuordnen lassen, die aus den Interviews mit religiösen Autoritäten abgeleitet wurden.
[3] Die Debatten zum Erbrecht gehen in muslimischen Ländern über die Praxis des doppelten Erbteils hinaus und betreffen z.B. auch die Rechte von Witwen, Großeltern, Enkelkindern oder Eltern beim Tod ihrer Kinder.
[4] Zu beachten ist, dass solche Familienmodelle bisweilen auch in überwiegend muslimischen Ländern in der Minderheit sind.
[5] 2023 wurde eine beratende Instanz vom König beauftragt, einen Entwurf für eine Reform des Mudawwana auszuarbeiten. Ein erster Entwurf wurde im März 2024 vorgelegt. Der König hat bislang noch keine Entscheidung getroffen (Stand: 02.01.2025).
Bibliografie
Littérature
- Anderson, J. N. D. (1965), Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance. In: The International and Comparative Law Quarterly, 14 (2), S. 349-365.
- Barlas, Asma (2002), Believing women in Islam. Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur’an. University of Texas Press.
- Coulson, Noel J. (2008), Succession in the Muslim family. Cambridge University Press.
- Lamrabet, A. (2017). Islam et femmes. Les questions qui fâchent. Folio.
- Mernissi, F. (1989). Le Harem politique. Le prophète et les femmes. Albin Michel.
- Schneuwly Purdie, M., & Stegmann, R. (2019). Der Umgang mit dem Erbe. Positionen von Muslimen und Musliminnen in der Schweiz. Schweizerisches Zentrum für Islam und Gesellschaft, Freiburg.
Weiterführende Informationen
- Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundesamt für Justiz, Erbrecht, letzter Zugriff am 22.12.2024
- Schweizerische Eidgenossenschaft, ch.ch, Einfache Antworten zum Leben in der Schweiz, Familie und Partnerschaft, Erbfolge: Wer wieviel erbt, letzter Zugriff am 22.12.2024.